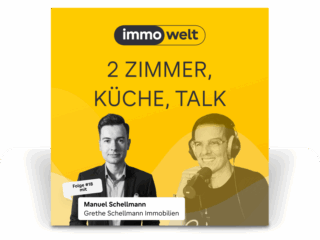01.07.2024
Ihr News-Update für die erfolgreiche
Hoffnung auf Eigenheim: Mehr Deutsche können sich den Kauf einer Wohnung leisten
In einigen Teilen Deutschlands ist Wohneigentum zuletzt wieder leistbarer geworden. Das ist das Ergebnis einer Studie des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) im Rahmen des Postbank Wohnatlas.
Laut Postbank-Experte Manuel Beermann sorgen gesunkene Kaufpreise und gestiegene Einkommen dafür, dass Durchschnittsverdiener in vielen Regionen leichter eine finanzierbare Eigentumswohnung finden. Der Anteil der Summe von Zins und Tilgung (Annuität) am Einkommen sank im vergangenen Jahr dem Bericht zufolge im Bundesschnitt um 5,1 Prozentpunkte auf 19,4 Prozent. Am kleinsten war das Verhältnis der fälligen Raten zum Haushaltseinkommen im thüringischen Landkreis Greiz (7,9 Prozent), gefolgt vom sächsischen Vogtlandkreis (8,0 Prozent) und dem brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster (8,4 Prozent). Mit Abstand am unerschwinglichsten ist Eigentum den Berechnungen zufolge im Landkreis Nordfriesland (59,8 Prozent). Zu ihm gehören die Inseln Sylt, Amrum und Föhr. Am zweitteuersten war München mit 46,7 Prozent, gefolgt von Berlin auf Platz drei (46,4 Prozent).
Buschmann: Mietpreisbremse soll bis 2028 verlängert werden
Geht es nach Bundesjustizminister Marco Buschmann, soll die Mietpreisbremse bis Ende 2028 verlängert werden. Dazu legte sein Ministerium einen Gesetzentwurf vor. Ob es dazu jedoch auch kommt, ist fraglich.
Denn der Entwurf ist noch nicht innerhalb der Regierung abgestimmt. Der Entwurf sieht außer der Verlängerung auch schärfere Anforderungen vor, die ein Gebiet erfüllen muss, um eine Mietpreisbremse umsetzen zu können. Unter anderem sollen bisherige Maßnahmen dargelegt werden, die die Gemeinde unternommen hat, um die Situation zu verbessern. Die Mietpreisbremse läuft nach jetzigem Stand 2025 aus. Sie regelt, dass die neue Miete bei einem Mieterwechsel nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf.
Der Inhalt befindet sich hinter einer Paywall.
Digitaler Bauantrag nimmt Fahrt auf
10 Bundesländer nutzen inzwischen die vom Land Mecklenburg-Vorpommern entwickelte Plattform für den digitalen Bauantrag. So soll das Verfahren bundesweit möglichst einheitlich werden, obwohl Baurecht Ländersache ist. Langsam geht es voran.
582 der 691 Bauaufsichtsbehörden in den beteiligten Ländern sind mittlerweile bereit, das Verfahren zu nutzen. In den bereits an das System angeschlossenen 452 Behörden sind bisher schon über 2.000 digitale Bauanträge eingegangen. Verglichen mit den jährlich 220.000 Anträgen deutschlandweit ist das noch nicht viel, jedoch ein guter erster Schritt seit dem Start des Projekts im Mai. Ein deutschlandweit einheitliches Verfahren wird es allerdings vorerst nicht geben. Manche Bundesländer wie Berlin und Bayern haben sich für ein eigenes System entschieden. Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr meldet allerdings, dass der digitale Bauantrag im Freistaat derzeit bereits in 84 Städten und Landratsämtern möglich ist.
Weiterlesen auf Handelsblatt.com
Der Inhalt befindet sich hinter einer Paywall.
Handwerker fehlen: Klimaneutraler Gebäudebestand bis 2045 rückt in weite Ferne
Bis 2045 soll der Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral werden. Doch dieses Ziel rückt laut einer Studie in weite Ferne. Die Produktion im Bausektor müsste deutlich erhöht werden – doch dafür gibt es zu wenig Personal. Wann kann mit dem Erreichen des Ziels gerechnet werden?
Eventuell erst 30 Jahre später, wenn man der Studie des Münchner Beratungsunternehmens S&B Strategy Glauben schenkt. Diese trägt den vielsagenden Titel: „Klimaneutralität erst 2075+?“. Laut Fabio P. Meggle, Co-Autor der Studie fehlen schlichtweg die Handwerker, um die notwendigen Sanierungen durchzuführen. Das Problem ist, dass nicht nur alte Heizungen gegen umweltfreundlichere ersetzt werden müssen. Laut der Studie müsse bei rund 15,7 Millionen der 20 Millionen Bestandsgebäude auch die Dämmung an Dächern, Fassaden oder Fenstern optimiert werden. Während man bei Fenstern und Wärmepumpen auf einem guten Weg sei, seien vor allem die Dächer das Problem, so die Autoren der Studie. Rund die Hälfte aller Dächer im Bestand sei sanierungsbedürftig. Um bis 2045 alle erforderlichen Dächer zu sanieren, wäre eine Sanierungsquote von 6,3 Prozent pro Jahr nötig. 2023 lag diese aber bei lediglich 0,9 Prozent. Daher müsse die Produktivität im Bausektor drastisch gesteigert werden. Möglich wäre dies durch die Ausweitung der Vorkonfektionierung sowie die Schaffung neuer Geschäftsmodelle, schreiben die Experten.
Weiterlesen auf Handelsblatt.com
Der Inhalt befindet sich hinter einer Paywall.
Aktuelle Beiträge
 MagazinErbengemeinschaften als Akquise-Chance
MagazinErbengemeinschaften als Akquise-Chance