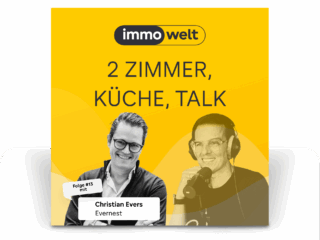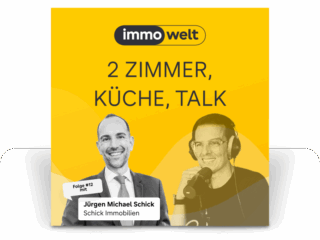13.02.2025
Ihr News-Update für die erfolgreiche
Wohnungsbau in Europa: In Skandinavien geht’s bergauf
Der Wohnungsbau in Europa erreicht den tiefsten Stand seit 2015. Der Norden zeigt sich widerstandsfähig, die Bautätigkeit nimmt dort bereits wieder zu. Für den Rest Europas bleibt die Lage angespannt.
Die Neubautätigkeit in Europa erreicht 2024 den tiefsten Stand seit 2015, mit nur 1,5 Millionen neuen Wohnungen – ein Rückgang von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so das ifo Institut und Euroconstruct. Während für viele europäische Länder ab 2025 eine Erholung prognostiziert wird, droht Deutschland ein weiterer Rückgang. 2025 könnten hier nur noch 205.000 neue Wohnungen entstehen, nach 250.000 im Vorjahr. Hauptgrund sind die hohen Baukosten, die den Markt weiterhin belasten. In Nordeuropa zeigt sich hingegen eine positive Entwicklung: In Schweden zieht die Bautätigkeit bereits wieder an, für Dänemark, Finnland und Norwegen wird eine weitere Erholung bis 2026 erwartet. In Österreich, Frankreich und Italien bleibt die Lage dagegen angespannt, dort könnte der Wohnungsbau noch weiter zurückgehen. Insgesamt rechnen die Forscher für Europa 2026 mit einem moderaten Anstieg der Neubautätigkeit um 3 Prozent.
Cancelling Bauministerium? Parteien streiten um die Grundlage des Wohnungsbaus
Die Zukunft des Bauministeriums nach der Bundestagswahl ist ungewiss. Wie bekannt wurde, stellt die Union ein eigenständiges Ministerium infrage und plädiert für eine Bündelung der Kompetenzen, unabhängig von der Ressortstruktur.
Die SPD und mögliche Koalitionspartner wie die Grünen befürworten den Erhalt, teils mit einer Erweiterung der Zuständigkeiten, etwa für Mietrecht und Klimaschutz im Gebäudebereich. Die FDP hingegen fordert die Abschaffung, da ein Ministerium kein Garant für bessere Politik sei.
Beim Gebäudeenergiegesetz (GEG) zeigt sich die Union moderater: Statt einer Abschaffung sollen lediglich die Änderungen der Ampel zurückgenommen werden. Die SPD signalisiert Änderungsbereitschaft, falls nötig. Die Grünen und Volt halten am GEG fest, während die FDP eine Integration in den Emissionshandel und damit eine Auflösung des Gesetzes fordert.
Der Inhalt befindet sich hinter einer Paywall.
Initiative: Eigenbedarfskündigungen sollen schärfer begründet werden
Der rot-grüne Hamburger Senat will eine Bundesratsinitiative starten, um Mieterrechte bei Eigenbedarfskündigungen zu stärken.
Ziel der Initiative ist es die Kündigungsfrist auf 6 Monate zu verlängern, die Begründungspflicht zu verschärfen und Vermieter zu verpflichten, alternative Wohnungen anzubieten. Zudem soll es nach dem Kauf einer vermieteten Wohnung eine Sperrfrist für Eigenbedarfskündigungen geben. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) kritisiert, dass Vermieter Eigenbedarfskündigungen missbrauchen, um Mieter loszuwerden und anschließend teurer neu zu vermieten. Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) warnt, dass Mieter in angespannten Wohnungsmärkten besonders gefährdet seien. Der Entschließungsantrag wird am Freitag im Bundesrat vorgestellt.
Hausverwalter: WEGs müssen erneut tiefer in die Tasche greifen
Die Basissätze für WEG- und Mietverwaltungen sind 2024 erneut gestiegen, das ergibt die CRES-Entgeltstudie. Der Grund für die höheren Kosten sind Zusatzaufgaben wie energetische Sanierungen oder neue gesetzliche Vorgaben, die die Arbeitsbelastung weiter erhöhen.
Bei Neuabschlüssen zahlen Wohnungseigentümergemeinschaften zwischen 27,37 und 41,65 Euro pro Einheit und Monat – ein Anstieg von rund 4 Euro im Vergleich zu 2023. In der Mietverwaltung liegt die Steigerung bei 5,50 Euro.
Immer mehr Verwalter rechnen Sonderleistungen ab, etwa für bauliche Maßnahmen oder zusätzliche Eigentümerversammlungen. Besonders kleine Objekte haben es schwer, eine Verwaltung zu finden, da die Fixkosten hoch sind. Ab 8 bis 9 Einheiten wird eine Verwaltung erst kostendeckend.
Zudem steigt die Arbeitsbelastung durch gesetzliche Vorgaben wie das Gebäudeenergiegesetz und die Einführung der E-Rechnung. 88 Prozent der Verwaltungen bewerten ihre Auslastung als hoch. Trotz steigender Anforderungen zeigt die Studie, dass 44 Prozent der Verwalter expandieren wollen – ein deutlicher Anstieg gegenüber 2023.