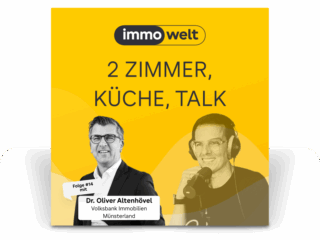17.10.2025
Ihr News-Update für die erfolgreiche
Immobilienpreise steigen vielerorts
Die Immobilienpreise in Deutschland steigen weiter. Neue Daten zeigen, in welchen Regionen Kaufimmobilien besonders teuer geworden sind, wo sich die Preise stabilisieren und wo sie trotz der allgemeinen Entwicklung sogar gesunken sind. Laut dem neuen Immobilienpreisindex von Empirica Regio, der dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, kosten Neubauwohnungen im Durchschnitt 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders deutlich stiegen die Preise im Osten, etwa im thüringischen Sömmerda mit einem Plus von 59,2 Prozent. Die teuerste Region bleibt der Großraum München mit mehr als 11.000 Euro pro Quadratmeter. In einigen Landkreisen Bayerns und Baden-Württembergs sind die Preise jedoch leicht gefallen. Experten sehen die Gründe für die Verteuerung von Kaufimmobilien in steigenden Mieten und einem stabilen Zinsumfeld, warnen aber vor sozialer Ungleichheit auf dem Wohnungsmarkt. Wie der Europace-Hauspreisindex zeigt, verteuerten sich auch Bestandsimmobilien: Ein- und Zweifamilienhäuser stiegen um 2,54 Prozent im Jahresvergleich, Eigentumswohnungen um 3,19 Prozent. Parallel dazu erhöhten sich die Angebotsmieten laut VALUE AG im Jahresvergleich um 5,7 Prozent, was die anhaltende Knappheit auf dem Wohnungsmarkt verdeutlicht. Fachleute sehen den Grund in zu wenig Neubau und warnen: Ohne spürbaren Bauturbo dürfte der Druck auf die Preise weiter zunehmen.
Weiterlesen auf Handelsblatt.com
Der Inhalt befindet sich hinter einer Paywall.
Reform des Heizungsgesetzes verzögert sich weiter
Die Bundesregierung will das Gebäudeenergiegesetz (GEG) überarbeiten. Eine Novelle des Heizungsgesetzes war eine zentrale Wahlkampfansage der neuen Regierung, doch eine Einigung innerhalb der Koalition steht weiterhin aus. Laut Bundeswirtschaftsministerium sollen bis Jahresende 2025 zumindest die Eckpunkte der Reform feststehen. Ein fertiger Gesetzentwurf wird aber frühestens Anfang 2026 erwartet. Im Mittelpunkt des Streits steht weiterhin die sogenannte 65-Prozent-Regel. Sie besagt, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Die Union will diese Vorgabe abschaffen, während die SPD sie beibehalten möchte. Ziel der Regierung ist es, eine Neuauflage des Gesetzes zu vermeiden, die erneut für politische Spannungen sorgt. Die Reform muss zudem mit der EU-Gebäuderichtlinie abgestimmt werden, die bis Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Diese sieht einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 vor. Weiterhin offen bleibt, in welchem Umfang der Staat den Austausch alter Heizungen künftig fördern wird. Im Gespräch sind neben Zuschüssen auch steuerliche Anreize. Sicher ist bislang nur: Eine grundlegende Neuausrichtung des Heizungsgesetzes wird somit erst 2026 in Kraft treten.
Studie: Junge Österreicher leiden besonders unter steigenden Wohnkosten
Die Wohnkrise in Österreich trifft junge Menschen besonders hart. Eine neue Studie zeigt, wie stark steigende Kosten, Platzmangel und Lärm die Lebensqualität beeinträchtigen und warum viele trotz Unzufriedenheit nicht umziehen können. Laut einer Erhebung im Auftrag von immowelt.at machen sich mehr als drei Viertel der unter 30-Jährigen Sorgen um ihre Wohnsituation, während nur ein Drittel zufrieden ist. Besonders belastend sind die hohen Wohnkosten: Nur 12 Prozent empfinden sie als sehr gut leistbar. Zwar wünschen sich 76 Prozent der jungen Erwachsenen einen Umzug in den nächsten fünf Jahren, doch finanzielle Hürden und die wirtschaftliche Unsicherheit bremsen viele aus. Neben der Leistbarkeit sind vor allem Platz, Lage und Infrastruktur entscheidend – doch an genau diesen Punkten hapert es häufig.
Heizen wird für viele wieder bezahlbar
Trotz gesunkener Energiepreise haben Millionen Menschen in Europa weiterhin Probleme, ihre Wohnungen warmzuhalten. In Deutschland zeigt sich jedoch ein positiver Trend, denn immer weniger Haushalte können nicht ausreichend heizen. Laut Statistischem Bundesamt konnten sich 2024 rund 5,3 Millionen Menschen hierzulande keine ausreichende Wärme leisten, was 6,3 Prozent der Bevölkerung entspricht. Im Jahr zuvor waren es noch 8,2 Prozent. EU-weit berichteten 9,2 Prozent von finanziellen Schwierigkeiten beim Heizen. Besonders stark betroffen sind Bulgarien und Griechenland, während Finnland die niedrigste Quote aufweist. Trotz eines leichten Rückgangs der Energiepreise bleiben die Kosten auf hohem Niveau. Heizöl, Gas und Fernwärme haben sich seit 2020 teils nahezu verdoppelt und belasten viele Haushalte weiterhin spürbar.